Interpersonelle Konzepte spielen im agilen Projektmanagement eine wesentliche Rolle, da hier der Teambegriff und die selbstorganisation von Teams eine wichtige Größe darstellt. In den interpersonellen Konzepten zählen grundsätzlich gruppenpsychologische Phänomene wie beispielsweise Konfliktlösung, Verhandeln, Kommunikation, Kooperation, usw. zu den Erfolgsfaktoren im agilen Projektmanagement.
Prozesse zwischen Gruppen
An dieser Stelle sollte der Begriff Gruppe abgegrenzt werden, um ein gemeinsames Verständnis im weiteren Verlauf sicher zu stellen:
Mindestens zwei oder mehrere Personen, die gemeinsam ein oder mehrere Ziele verfolgen und dadurch miteinander kooperieren und interagieren müssen, wird als Gruppe und die einzelnen Personen als Mitglieder der Gruppe bezeichnet.
Das Verhalten und die Einstellung einer einzelnen Person kann sich in einer Gruppe grundlegend von dem individuellen Verhalten unterscheiden[1]. Im alltäglichen Gebrauch sollten folgende Indikatoren vorliegen, um von einer Gruppe sprechen zu können[2]:
Die Mitglieder –
- einer Gruppe erleben und definieren sich als zusammengehörig.
- verfolgen gemeinsame Ziele.
- teilen Normen und Verhaltensvorschriften für bestimmte Verhaltensbereiche.
- entwickeln Ansätze von Aufgabenteilung und Rollendifferenzierung.
- haben mehr Interaktion nach innen als nach außen.
- identifizieren sich mit einer Bezugsperson, einer Aufgabe oder einem gemeinsamen Sachverhalt.
- sind räumlich und/oder zeitlich von anderen Individuen der weiteren Umgebung abgehoben.
Für das agile Projektmanagement sind die Indikatoren des unmittelbaren Kontaktes zwischen den Mitgliedern der Gruppe und die Gruppengröße noch von entscheidender Bedeutung[3].
Dem Projektleiter sollte beim agilen Vorgehen bewusst sein, dass neben der Bezugsgruppe, die im agilen Projektmanagement angestrebt wird, auch Mitgliedschaftsgruppen (z.B. höherer Führungskreis) existieren, die die Gruppen- bzw. Teamentwicklung beeinflussen können. Eine Bezugsgruppe, in diesem Fall eine Projektgruppe bzw. –team, basiert darauf, dass sich das Teammitglied daran orientieren kann und im Sozialisationsprozess normative und Vergleichsfunktionen durchlaufen werden. Hat man beispielsweise ein Mitglied in der Gruppe welches gerade in den höheren Führungskreis befördert worden ist und in diesem Sinne auch ehrgeizig ist, kann sich hier eine Mitgliedschaftsgruppe auch sehr schnell in eine weitere Bezugsgruppe entwickeln und u.U. für dieses Teammitglied anfänglich mehrere Zielkonflikte ergeben[4].
Formelle Gruppen und deren Mitglieder werden durch die Organisation mit Aufgaben, Rechte und Pflichten versehen und sind strukturell miteinander verankert. Das Verhalten der Mitglieder ist i.d.R. vorgeschrieben. Meist sind solche Strukturen in einem Organigramm abgebildet.
Informelle Gruppen entstehen durch die Individuellen Bedürfnisse der Mitglieder. Neben den privaten Gruppen, wie beispielsweise die Verwandtschaft oder der Freundeskreis, existieren auch in einer Organisation informelle Gruppen, die auch über Hierarchieebenen und Abteilungen verteilt sein können[5].
Bei der Zusammenstellung von Mitgliedern einer Gruppe ist bei der Teamentwicklung von agilen Teams noch die Form der Zusammenarbeit wichtig. Koagierende Mitglieder führen ihre Tätigkeiten relativ unabhängig voneinander aus, während interagierende Mitglieder stark miteinander kooperieren und ihre Tätigkeiten abhängig voneinander ausführen und koordinieren müssen. Hier unterscheidet man[6]:
- Aufgabeninterdependenz (z.B. Warum müssen die Mitglieder kooperieren?)
- Ergebnisinterdependenz (z.B. Wie müssen die Mitglieder kooperieren?)
- Feedbackinterdependenz (z.B. Was müssen wir in der Kooperation verbessern?)
Die Aufgabeninterdependenz legt die Grundlage für den Kooperationsbedarf fest. Aufgaben, die keiner Kooperation bedürfen benötigen keine Gruppenarbeit und die Mitgliedschaft in einer Gruppe kann sogar störend auf die Tätigkeit aufgefasst werden. Die Ergebnisinterdependenz stellt den Motivationsaspekt in der Gruppenarbeit dar, der meist als Ziel formuliert ist (siehe »Motivation und Volition«). Möchte sich die Gruppe sukzessive verbessern ist die Feedbackinterdependenz (siehe »Daily-Meeting« und »Retrospektive«) wichtig, um das individuelle und organisationales Lernen zu fördern[7].
Kooperation und Konkurrenz
Kooperation gilt als Form der Zusammenarbeit zwischen Personen und Gruppen in denen soziale Interaktionen ablaufen. Eine Kooperation ist ein bewusstes und geplantes Handeln das die Zusammenarbeit unterstützt und Abstimmungen untereinander fördert. Die Partner einer Kooperation erkennen öffentlich bestimmte Regeln und Verfahren an. Kooperation ist ein Strukturprinzip von Gruppen das besonders für jede Art menschlicher Zusammenarbeit notwendig ist[8].
Das Gegenteil von Kooperation ist Konkurrenz bzw. der Wettbewerb indem man versucht andere zu übertreffen. Das Positivum darin ist, dass es einzelne Personen zu hoher Leistung anspornen kann. Das Negativum ist, dass in einer Gruppe wettbewerbsorientiertes Verhalten auch Gefahrenpotentiale birgt, die ein effektives Zusammenarbeiten stören oder sogar zerstören können. In manche Personengruppen oder Situationen wird kooperatives Verhalten sogar als Schwäche interpretiert[9].
Ein Auftraggeber möchte beispielsweise in einem Projekt eine Änderung an einem IT-System kostenlos durchsetzen und entwickelt sich zu einem Konfliktpartner für den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer möchte aber für die Änderung die vollen Kosten dafür erstattet haben. Beide Parteien haben nun ein Problem und liegen im Konflikt miteinander. Ausgehend davon, dass beide Parteien rationale Entscheidungsprozesse durchlaufen und die Entscheidung über das entstandene Problem räumlich getrennt stattfindet, kann man dieses Beispiel in der Literatur auch unter dem Begriff »Gefangenen-Dilemma« finden[10].

Beharren beide Parteien im obigen Beispiel auf ihrer Position, kommt es für beide Seiten zu hohen Kosten (monetär, aber auch im Verhalten zwischen den beiden Parteien) oder sogar zum Abbruch des Projektes, was in der Abbildung oben »Gefangenen-Dilemma« im Quadrant IV dargestellt wird.
Geht der Auftragnehmer auf die Forderung des Auftraggebers ein, so entstehen auf Seiten des Auftragnehmers sehr hohe Kosten, die im Quadrant III dargestellt sind[11].
Dieselben hohen Kosten auf der Auftraggeber-Seite, wenn der Auftraggeber in der Sache nachgibt (Quadrant I). Alle drei Strategien (siehe auch unten »Konflikt und Konfliktlösung«) sind entweder für beide nicht optimal, oder für wenigstens einer der beiden Parteien.
Als ideal würde man in diesem Beispiel den Quadrant II einstufen. Quadrant II beschreibt hier die kooperative Strategie. So stehen jedem Teilnehmer zwei Handlungsalternativen zur Verfügung, die eine kooperativ und die andere kompetitiv (Wettbewerb, Konkurrenz). In der Praxis gibt es auch Mischformen in den Strategien, die als »mixed-motives« bekannt sind und sowohl eine kooperative als auch eine kompetitive Strategie enthalten[12].
Beim strategisch-kooperativen Handeln sucht sich das Individuum oder der Kunde einen Partner, der ihn in seinen Zielen unterstützt und seinen Nutzen rational und zielgerichtet kalkuliert (siehe »Einführung der Backlogs«). Bei der strategisch-kooperativen Handlungsweise fehlt es aber meist an der empathischen Kooperation, die aber als Voraussetzung gilt, wenn man »echte« Kooperation entwickeln möchte. Diese Kooperation kann soweit fortschreiten, dass es beim Individuum zu Wahrnehmungsverzerrungen kommen kann (z.B. Stockholm-Syndrom).
Konflikt und Konfliktlösung
In und um Projekte sind Konflikte etwas Alltägliches. Ein Konflikt wird in der Psychologie als Spannungssituation bezeichnet, in denen unterschiedliche, voneinander abhängige Parteien bewusst oder unbewusst inkompatible Handlungen, Pläne und Strategien realisieren oder realisieren wollen. Die Ursachen von Konflikten können vielfältig sein und zum Beispiel in Personen mit ausgeprägtem Machtmotiv oder in Strukturen wie ungerechte Verteilung von Informationen, Gütern, etc. liegen. Latente Konflikte sind gegenüber von offenen Konflikten meist unbemerkt und verdeckt und werden meist nicht erkannt. Frühindikatoren für latente Konflikte können zum Beispiel steigendes Misstrauen, Abwesenheit, unpassende Bemerkungen (siehe »Einführung von User Stories«) sein, deren Bedeutung erst im Nachhinein bewusst wird[13].
Eskalation und Deeskalation können den Grad und die Intensität von Konflikten aufnehmen und beschreiben. Eine Eskalation beschreibt eine steigende Feindseligkeit, Tendenzen von einer anfänglichen Kooperation zur Konkurrenz und meist extreme Forderungen[14] und Handlungen. Es gibt drei Phasen der Eskalation, die jeweils in drei Stufen unterteilt sind. Die Konflikte eskalieren von einer Stufe zur nächsten[15]:
Phase 1 (win-win): Rationalität und Kontrolle
- Versuche zu kooperieren
- Polarisation
- Interaktion anhand von Taten
Phase 2 (win-lose): personalisiert auf andere Partei, Schwarz-Weiss-Denken
- Sorge um den Ruf der Koalition
- Geschichtsverlust
- Überwiegen von Drohstrategien
Phase 3 (lose-lose): Aggression und Destruktion
- Destruktive Kampagnen
- Angriffe auf Machtzentren des Feindes
- Totale Destruktion

Die Voraussetzungen und Kennzeichen bei der Gewinn-Gewinn-Strategie sind ungezwungene Meinungsäußerungen, gegenseitiges Vertrauen, freier und transparenter Zugang zu Informationen und Partizipation.
Bei der Gewinn-Verlust-Strategie gewinnt eine Partei und die andere verliert. Kennzeichen und Methoden dafür sind Autoritätsausübung, Machtautorität, Indifferenz und Mehrheitsentscheid.
Kennzeichen bei der Verlust-Verlust-Strategie sind Kompromisse, Kompensation oder die Hinzunahme von Dritten.
Verhandeln
Eine Verhandlung ist eine Diskussion zwischen Personen oder Gruppen zweier oder mehrerer Parteien, die versuchen eine Interessensdivergenz zu lösen um soziale Konflikte zu vermeiden. Man kann davon ausgehen, dass Parteien, die verhandeln auch an einer Übereinkunft interessiert sind. Ist die Übereinkunft das Nebeninteresse einer Verhandlung, so wird dieses Mittel meist für Verzögerungstaktiken eingesetzt um Zeit bzw. Kräfte (z.B. fehlende Ressourcen, etc.) zu gewinnen. Pruitt & Carnevale unterscheiden hier fünf unterschiedliche Verhandlungsstrategien[16]:
- Konzessionen: Eigene Ziele und Forderungen werden zurückgestellt
- Kämpen: Überzeugen, Drohen, Beharren
- Problemlösen: Lösungen finden, die die Ziele beider Parteien befriedigen
- Untätigkeit: So wenig wie möglich erledigen, Treffen verschieben
- Rückzug: Verhandlung verlassen
Das Dual-concern-Modell nach Pruitt und Rubin verdeutlicht die Zusammenhänge um die Sorge der eigenen Handlungsergebnisse und die Sorge um die Handlungsergebnisse des anderen. Je nachdem, wie die Dimensionen fallen, werden verschiedene Reaktionen ausgelöst.

Droht beispielsweise ein Auftraggeber mit Rücknahme des Auftrags und identifiziert der Auftragnehmer dies als ein reales Handlungsergebnis, so kann der Auftragnehmer, da er sich um das Handlungsergebnis des Auftraggebers sorgt, eher nachgeben. Insofern befindet sich der Auftraggeber in der Verhandlungsstrategie »Kämpfen« und der Auftragnehmer in der »Konzession«.
[1] Kutschker, Michael, Schmid, Stefan: Psychologie der Gruppe; 9. Auflage; Juventa Verlag; Weinheim und München; 2008; S.37f.
[2] Kutschker, Michael, Schmid, Stefan: Psychologie der Gruppe; 9. Auflage; Juventa Verlag; Weinheim und München; 2008; S.39.
[3] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.47.
[4] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.47.
[5] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.48f.
[6] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.49.
[7] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.49ff.
[8] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.57.
[9] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.58ff.
[10] Wiese, Harald: Entscheidungs- und Spieltheorie; 1. Auflage; Springer-Verlag; Berlin Heidelberg; 2002; S. 122-138.
[11] Zudem könnte dieses Verhalten mittel- und langfristig als Schwäche ausgelegt werden und den Kunden trotzdem nicht zufrieden stellen.
[12] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.58.
[13] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.62.
[14] Der Partner verfällt in ein Schwarz-Weiß-Muster.
[15] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.63.
[16] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.66f.
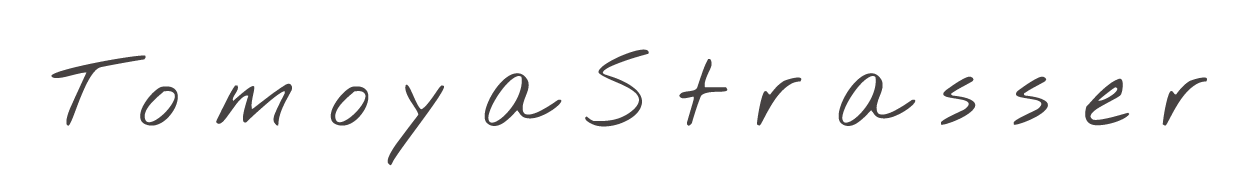
Comments: 3
[…] den Projekterfolg auswirken können. Ein bewusstes Verständnis von Verhaltensmustern kann helfen, Konflikte zu vermeiden oder effektiv zu lösen, die Kommunikation zu verbessern und die Teamarbeit zu […]
[…] zusammen zu arbeiten, weiß ich, dass hinter jedem erfolgreichen Projekt oder Produkt ein besonders Team […]
[…] bezieht sich auf die gezielte Beeinflussung des Verhaltens von Individuen oder Teams, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Sie beruht auf der Annahme, dass das […]