Alle Prozesse, wie beispielsweise der Sozialisationsprozess, die in der frühen Kindheit oder einer Organisation ablaufen aber auch gesellschaftliche Prozesse, wie die »Globalisierung«, werden unter dem Begriff »Umweltebene« zusammengefasst[1]. Im agilen Projektmanagement werden sowohl die Organisationsprozesse, wie die Sozialisation oder die Arbeitszufriedenheit, als auch gesellschaftliche Prozesse, wie die Werte und Kultur, angewandt.
Sozialisation
Im Sozialisationsprozess wird das Teammitglied an die Arbeits- bzw. Projektorganisation angepasst, wobei er durch den durchlaufenen Teamentwicklungsprozess (Einführungsschulungen, notwendige Arbeitsmittel stehen bereit, Zugänge sind freigeschaltet, etc.) und den Projektleiter[2] unterstützt wird. Der Prozess der Sozialisation lässt sich grundsätzlich in drei Phasen einteilen[3]:
Die erste Phase, die »Voreintrittsphase«, dient dem Teammitglied dazu, eine Fremd- und Selbstselektion durchlaufen zu können. In dieser Phase ist es u.a. wichtig, der Person eine klare Vorstellung durch eine sog. »realistic job preview« zu geben, was von diesem erwartet wird[4]. Bezieht man sich nun auf das agile Projektmanagement, kann dies für den Projektleiter bedeuten, dass man einen Spezialisten darauf vorbereitet, sein Wissen im Team zu kommunizieren, auch wenn die ersten Ansätze dieses Wissen weiterzugeben mühevoll sein können, da die anderen Teammitglieder oft inhaltlich noch keine Vorstellung davon haben. Wichtig ist auch, den Spezialisten darauf vorzubereiten, dass er sein Wissen, für in für Laien verständliche Teile, aufbereiten muss und in der Lage sein muss, diese Informationen dem Team präsentieren zu können, damit dieses Wissen in den Entscheidungsprozess (siehe »Entscheidungsprozesse«) mit einfließen kann. Der Spezialist muss auch verstehen, dass Entscheidungen, die in seiner Wissensdomäne liegen, auch im Teamkontext gefällt werden müssen, damit sich die anderen Teammitglieder mit der getroffenen Entscheidung identifizieren können.
Die zweite Phase, die »Eintrittsphase«, ist für das Teammitglied durch ständiges Abgleichen mit seiner Umwelt geprägt. Die Person muss sich in dieser Phase seiner Umwelt anpassen und wird andererseits von seiner Umwelt getestet, ob es in diese auch passt. Diese Phase hat im Sozialisationsprozess weitreichende Folgen bzgl. der späteren Bindung und Entwicklung des Teammitglieds an seine Umgebung. Auch die soziale Unterstützung spielt in der Eintrittsphase eine wesentliche Rolle, wobei man darauf achten sollte, dass die Kombination der Ansprechpartner aus Kollegen und Führungskräften ausgewogen und nicht zu einseitig ist. Es gibt zahlreiche Konflikte und Defizite, die in dieser Phase entstehen und sich entwickeln können[5]. Da im agilen Projektmanagement das Team im Vordergrund steht, kommt dieser sehr aktiven Phase eine wesentliche Bedeutung zu. Lässt man beispielsweise das Mitglied zu sehr auf sich gestellt, wird es sehr schnell zu Einarbeitungskonflikten kommen. Wichtig ist in dieser Phase auch, dass man als Projektleiter darauf achtet, dass keine allzu starke quantitative Rollenübertagung an das neue Mitglied, durch zu viel Routinetätigkeiten oder zu viel Arbeit passiert. Sowohl das Team als auch der Projektleiter sollte besonders bei Spezialisten darauf achten, dass diese ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in das Team einbringen können, um keinen Professionskonflikt entstehen zu lassen. Existiert eine Rollenbeschreibung, die dem Teammitglied in der Voreintrittsphase vorgestellt worden ist und mit ihm abgestimmt wurde, so ist es trotzdem wichtig, dass man als Projektleiter beobachtet, wie diese Person und die Rolle sich im Arbeitsumfeld entwickelt, um eine spätere Rollenambiguität zu vermeiden. Der Projektleiter sollte in dieser Phase darauf achten, dass das Mitglied regelmäßig Feedback (siehe »Daily-Meeting«) erhält und in seiner Kompetenz begleitet, gefordert und gefördert wird, um Feedbackdefizite und Kompetenzkonflikte von Anfang an zu vermeiden. Schafft es der Projektleiter nicht, die Konflikte und Defizite wenigstens annähernd zu kompensieren und zu vermeiden, kann es sehr schnell zu Konflikten im Team (Intra-Gruppenkonflikt) kommen oder das Teammitglied sich über einen Entfremdungsprozess sukzessive von seiner Arbeit innerlich distanzieren.
In der dritte Phase, die »Phase der Metamorphose«, befindet sich der Transformationsprozess der Sozialisation im Endstadium der Sozialwerdung. Das Teammitglied sollte in dieser Phase weitestgehend die vorherrschenden Werte und Einstellungen adaptiert haben[6]. Durch spezielle Aufgaben, Fort- und Weiterbildungen oder gemeinsame Aktivitäten im Team kann die Sozialmachung zusätzlich sukzessive entwickelt und ausgebaut werden. Das agile Projektmanagement hat im Bereich der Sozialwerdung und Sozialmachung Werkzeuge und Methoden wie beispielsweise das Daily Meeting oder die Retrospektiven, die dem Projektleiter dabei helfen. Überdies hinaus sind auch gemeinsame Aktivitäten im Team im privaten Umfeld (Essen gehen, Bowling, etc.) förderlich.
Arbeitszufriedenheit
Die Arbeitszufriedenheit ist ein »soziales Effizienzkriterium« und wesentlich, die Arbeit eines Teammitglieds nicht nur monetär sondern auch immateriell bewerten zu können und gilt als relativ stabile Haltung des Menschen, da es große Überschneidungen mit dem intrapsychischen Konzept »Einstellung« gibt.
Arbeitszufriedenheit zeigt auch eine große Nähe zu den Motivationstheorien. Im einfachsten Fall kann man auch davon ausgehen, wenn ein Teammitglied motiviert ist, ist dieser auch zufrieden. Als Projektleiter eines agilen Projekt-Managements sollte man sich aber immer im Klaren sein, dass in einer privatwirtschaftlichen Organisation mitarbeiterorientierte Ziele gegenüber den wirtschaftlichen Zielen eher zwischengeschaltet sind und viele Organisationen oder Teile davon heute noch dieses Gedankengut letztendlich verinnerlicht haben.
In den neueren Managementkonzepten, wozu auch das agile Projektmanagement gehört, werden neben der Kundenzufriedenheit und den Geschäftsergebnissen auch der Mitarbeiterzufriedenheit explizit ein gewichtiger Faktor eingeräumt[7]. Als erfolgreicher Projektleiter für agiles Projektmanagement sind die zentralen Ergebniskriterien, zunächst vor allem betriebswirtschaftlicher Art, wie beispielsweise Rentabilität und Produktivität und in diesem Zusammenhang die Kombination aus Arbeitszufriedenheit und Leistung interessant.
Nach dem Modell von Bruggemann gehen Menschen von einem Sollzustand aus, der aufgrund ihrer Bedürfnisse und Erwartungen gebildet wird. Dieser Sollzustand wird dem aktuellen Istzustand der Arbeitssituation gegenübergestellt. In diesem Modell tendiert dann die Person zu einer stabilisierenden Zufriedenheit oder zu einer diffusen Unzufriedenheit (siehe unten Abbildung »Modell der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann«).

Stabilisiert Zufriedene Teammitglieder finden ihre Arbeitssituation befriedigend und versuchen diese aufrecht zu erhalten. In diesem Fall können einzelne Teammitglieder durch weitere Zielvorstellungen wachsen (sog. progressive Arbeitszufriedenheit) und es entstehen neue Motivationen, die durch eine Art »schöpferische Unzufriedenheit« erzeugt werden. Ähnliches gilt, wenn sich das Teammitglied in einer unbefriedigenden Situation befindet und diese auch bewusst wahrnehmen kann. Hier können neue Problemlösungsversuche, ausgelöst durch eine konstruktive Arbeitsunzufriedenheit, des Teammitglieds die Situation verändern, vorausgesetzt die Veränderungsmotivation ist entsprechend hoch und wird, wie beispielsweise bei der Retrospektive (siehe »Retrospektive«), gefördert. Umgekehrt kann es zu einer fixierten Arbeitsunzufriedenheit kommen, wenn eine unzufriedene Situation vorherrscht und diese auch wahrgenommen wird, aber das Teammitglied in seiner Veränderungsmotivation gehindert wird oder der Aufwand, die Veränderung anzustreben, zu hoch ist. Ist eine Situation unbefriedigend und nicht lösbar, kommt es zu einer Pseudoarbeitszufriedenheit, wenn das Anspruchsniveau nicht gesenkt werden kann. Das Teammitglied arrangiert sich mit der Situation durch Verdrängung oder Verfälschung und macht diese so erträglich[9].
Die Arbeitszufriedenheit hat eine wesentliche Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit, die im agilen Projektmanagement einen integralen Bestandteil des agilen Manifests darstellt (siehe »Agile Werte und Grundsätze«) und im Dienstleistungsbereich besonders wichtig ist.
Zufriedene Teammitglieder können eine höhere Qualität ihrer Arbeitsleistung liefern. In dem »Job Characteristics Model« von Hackman und Oldham kann man die verschiedenen psychologischen Erlebniszustände und deren Auswirkungen anhand von fünf Merkmalen der Arbeit darstellen (siehe »Job Characteristics Model von Hackman und Oldham«).

Die fünf Merkmale des Job Characteristics Model[11]:
- Anforderungsvielfalt: Die Aufgaben sollen die unterschiedlichen Fähigkeiten des Teammitglieds fordern und nicht einseitig sein (siehe »Task- und Kanbanboard«).
- Ganzheitlichkeit: Wird ein Vorhaben durchgeführt, ist es wichtig, dass das Teammitglied eine Vorstellung für das gesamte Produkt, welches erstellt wird, gewinnt (siehe »Product- und Sprint-Backlog«).
- Bedeutsamkeit: Dem Teammitglied sollte bewusst sein, welche Rolle seine Tätigkeit im gesamten Projekt einnimmt und erkennen, welche Bedeutung diese Tätigkeit hat (siehe »Einführung des Taskboards und des Daily Meetings«).
- Autonomie: Kann ein Teammitglied autonom handeln und arbeiten, so steigt die Verantwortung für die Arbeitstätigkeiten und –ergebnisse (siehe »Agile Werte und Grundsätze«).
- Rückmeldung: Das Teammitglied ist immer über die aktuellen Resultate und die Qualität der Arbeit informiert (siehe »Daily-Meeting« und »Retrospektive«).
Können über diese Aufgabenmerkmale die damit verbundenen psychologischen Erlebniszustände erfüllt werden, ist die Folge davon eine hohe Arbeitszufriedenheit und eine hohe intrinsische Arbeitsmotivation.
Commitment und Identifikation
Im agilen Projektmanagement ist die Verbundenheit (engl. Commitment) mit dem Team, dem Projektgegenstand und dem Umfeld ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Verbundenheit korreliert im Allgemeinen mit der Einstellung und der Arbeitszufriedenheit des Teammitglieds, mit dem dieser sich gegenüber dem Projekt, dem Team und dem Umfeld befindet. Verbundenheit erreicht man durch eine hohe Akzeptanz gegenüber den Zielen und den Werten im Projekt und der Anstrengung, diese zu erreichen. Der Wunsch, Teil des Ganzen sein zu wollen (Team, Projekt, etc.), ist der Motor für die Anstrengungen, die das Teammitglied antreibt. In schwierigen Situationen und kritischen Projekten oder wenn Ziele- und Wertedefinitionen außerhalb der Projekte ständig verletzt werden, kann die Arbeitszufriedenheit innerhalb dem Projekt ein wichtiger Faktor sein, um das Ergebnis trotz allem noch zu erreichen[12], da die Motivation hoch bleibt
Die Identifikation ist ein Maßstab, mit dem man beobachten kann, in wie weit sich ein Teammitglied eingebunden fühlt und sich mit den Zielen arrangieren kann. Die Identifikation ist für ein Team im agilen Projektmanagement ein wesentlicher Faktor, weil sich hier die Einstellung, die Verhaltensmerkmale und die Identifikationsprozesse zeigen[13].
Aus den Erfahrungen, die in Retrospektiven (siehe »Einführung der Retrospektive«) festgestellt werden, kann man eine innere und äußere Zufriedenheit gegenüber dem Projektgegenstand feststellen. Die innere Zufriedenheit entsteht, wenn das Teammitglied eine Verbundenheit mit dem Projektgegenstand (Team, Technologie, interessante Branche, etc.) aufbaut – Identifikation mit dem Projekt. Organisatorische und externe Störfaktoren (Veränderungen, Ruf der Organisation, strukturelle Probleme, usw.) spielen bezgl. der Verbundenheit und Identifikation zum Projekt eine untergeordnete Rolle.
Fehlt die innere Zufriedenheit, aufgrund des schwierigen und problembehafteten Projektgegenstandes, kann man trotzdem eine Verbundenheit gegenüber dem Projektgegenstand aufbauen, indem bereits eine äußere Zufriedenheit vorherrscht oder diese schrittweise aufbaut wird – Identifikation mit der Organisation. In diesem Zusammenhang könnten Organisationen sehr viel mehr leisten, indem man die Teammitglieder außerhalb des Projektgegenstandes unterstützt, motiviert und beiseite steht.
Erstrebenswert ist natürlich die Kombination aus beiden Faktoren, die aber im praktischen Umfeld nicht immer und notwendigerweise nicht zu hundert Prozent erreicht werden kann. Als Projektleiter sollte man sich natürlich speziell am Anfang, aber auch während der Projektlaufzeit, darüber klar werden, welche Eigenschaften der Projektgegenstand nach Außen gerade mit sich bringt und dementsprechend darauf reagieren. Anderseits ist es bei schwierigen und problembehafteten Projekten immer sinnvoll, die äußere Zufriedenheit gegenüber der inneren Zufriedenheit vorzuziehen, was auch bei sehr langen Projekten gilt.
Lernende Organisation
Anfangs wurde bereits die Herausforderungen an das eigene Geschäftsumfeld und die Anforderungen an ein modernes Projektmanagement aufgegriffen. Aus dieser Tatsache heraus, ist es notwendigerweise erforderlich, dass die Organisation mindestens mit der Geschwindigkeit lernt, wie die Veränderung des Umfelds dies verlangt (Arbeitsabläufe, Konkurrenz, Kundenerwartungen, usw.). Im agilen Projektmanagement ist der Projektleiter ständig mit dieser Situation konfrontiert und versucht die Tätigkeiten mit der notwendigen Geschwindigkeit, auszurichten. Organisationen verändern ständig ihre Innen- und Außenwelt, vergleichen das soeben gelernte in den Reflexionsphasen und ändern systematisch die Anforderungen, indem Probleme und Fehler analysiert werden. Dieser ständige Wandel der Arbeitswelt und die geforderte Flexibilität und Mobilität, besonders bei IT-Projekten, lässt die Halbwertszeit des Wissens und somit der individuellen Qualifikation sinken[14].
Im agilen Projektmanagement wird die Einstellung des ständigen Wandels durch den vierten Punkt im agilen Manifest dargestellt (siehe »Die Werte und Grundsätze des agilen Manifests«) und als Wertvorstellung bzw. Grundsatz manifestiert. Lernen hat in diesem Zusammenhang etwas mit Veränderung zu tun, wobei ein ständiges Feedback (siehe Abbildung »Job Characteristics Model von Hackman und Oldham«) an die Teammitglieder erforderlich ist, um diese auch befähigen zu können, diese Veränderungen umzusetzen. Ein kritischer Erfolgsfaktor für individuelles Lernen ist es, die Resultate aus der Praxis und dem Arbeitsalltag in Rituale, Praktiken, Strukturen und Selbstverständlichkeiten (siehe »Projekt – AgileWirkstatt«) übergehen zu lassen, wie zum Beispiel in der Retrospektive, um damit eine motivierende und karrierefördernde Wissensstruktur aufzubauen, in dem ein Fehler als (Lern-) Chance und Verbesserungsmöglichkeit begriffen wird[15].
Ein wichtiger Aspekt im agilen Projektmanagement ist es, das vorher in der Retrospektive Gelernte und Identifizierte sinnvoll wieder in einer ähnlichen Aufgaben- oder Problemsituation einzusetzen (siehe «Einführung der Retrospektive«). Solche, in einem Kontext gebundene Situationen sind i.d.R. auch nicht formal trainierbar und können nur in der Arbeitswelt in einem angewandten Lernprozess den Individuen angeeignet werden[16].
In diesem Zusammenhang wird im agilen Projektmanagement eine Umgebung geschaffen, die auf die Merkmale des einzelnen Teammitglieds eingeht und diesem eine Arbeitsumgebung schafft, das Gelernte einzusetzen und zu behalten. Um eine solche Lernumgebung zu schaffen sind folgende Faktoren zu berücksichtigen[17]:
- Authenzität: Die Umgebung und das Umfeld sollte die Realität widerspiegeln.
- Situiertheit: Der Anwendungskontext wird dem Teammitglied klar vor Augen geführt.
- Multiple Kontexte: Das erworbene Wissen sollte nicht nur auf eine bestimmte Situation bezogen werden, sondern auf unterschiedliche Kontexte und Abstraktionsgrade.
- Multiple Perspektive: Um Probleme, beispielsweise nicht von einer Ebene auf eine anderen Ebene zu verschieben (Rollen, Abteilungen, etc.), sollten unterschiedliche Sichten auf das Problem und dessen Inhalt reflektiert werden.
- Sozialer Kontext: Das neue Wissen sollte in einer kooperierenden Art und Weise erworben werden.
Das agile Projektmanagement versucht, angetrieben von den oben genannten Faktoren, die Lernumgebung soweit wie möglich in die Arbeitsumgebung einzubinden.
Netzwerke
Das agile Projektmanagement geht von selbstorganisierten und selbstlernenden Teams bzw. Individuen aus. Dies erfordert aber von jedem Teammitglied mittelfristig ein gutes Netzwerk, worin er sein benötigtes Wissen und die notwendigen Informationen erwerben und validieren kann.
In diesem Punkt hat das agile Projektmanagement innerhalb von Organisationen oftmals noch Schwierigkeiten, da darin immer noch regelorientierte und hierarchische Vorstellungen gelebt werden. Nutzt das Teammitglied neben den formellen Netzwerken auch noch die informellen bzw. sozialen Netzwerke, fühlt sich so mancher Manager oder Vorgesetzte als übergangen. Um heute in einem schnell verändernden Geschäftsumfeld ökonomisch handeln zu können, sind soziale Beziehungsnetzwerke ein wichtiger Erfolgsfaktor[18].
Netzwerke entstehen durch die freiwillige Zusammenarbeit mehrerer Personen die sich gegenseitig vertrauen, autonom arbeiten und durch Interdependenzen ihre Ziele und die Ziele der Personen im Netzwerk erfüllen können. In diesem Kontext ist es im agilen Projektmanagement notwendig, solche Netzwerke zu identifizieren, die richtigen Personen darin zu fördern, Interdependenzen vom Management zu fordern und durch Gruppenprozesse die Netzwerkteilnehmer dahingehend zu beeinflussen, indem man ein Team formt oder teamähnliche Arbeitsgruppen bildet (beispielsweise eine Technologie-Community).
Ein weiteres Ziel des Projektleiters ist es, Abstimmungsprozesse soweit zu fordern und zu fördern, dass sich einzelne Organisationseinheiten selber regulieren können und die Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern gelingt[19] (als Beispiel die Fachabteilungen). Da Netzwerke einer eigenen Strukturformel folgen, die nicht durch formelle Strukturen vorgegeben sind, nutzt man im agilen Projektmanagement einige dieser Vorteile[20]:
- Flexibilität
- Geschwindigkeit
- Wissensaustausch und selbstorganisiertes Lernen
- Reduzierung von Unsicherheiten
Als Projektleiter sollte man im agilen Projektmanagement darauf achten, dass es unterschiedliche Arten von Netzwerken gibt, die in sich unterschiedliche Aufgaben in Projekten erfüllen können.
Als erstes sollte man sich über die morphologischen Merkmale eines Netzwerkes bewusst werden. Die Merkmale sind u.a. die Größe des Netzwerkes – Anzahl der Netzwerkelemente, die Netzwerkdichte (mögliche und tatsächlich vorhandene Beziehungen) und der Grad der sozialen Integration (Zentralität).
Rationale Merkmale von Netzwerken und deren starke Beziehungen verwenden Teammitglieder, wenn diese emotionalen Rückhalt benötigen und ein uneingeschränktes Vertrauen innerhalb dieses Netzwerks vorliegt. Schwache Beziehungen dienen als Brücken zwischen den unterschiedlichen sozialen Systemen (beispielsweise Projektmitarbeiter und Fachabteilungen). Außerdem kommt man bei schwachen Beziehungen schneller an Informationen.
Die Orientierung an Verhaltensweisen, Grundsätze und Werte werden in den funktionalen Merkmalen (Sicherheit, soziale Unterstützung und Rückhalt) von Netzwerken unterstützt.
Werte und Kultur
Die Handlungen eines Teammitgliedes sind neben der aktuellen Situation und der kulturellen Einflüsse auch von seinen Werten, die er besitzt, abhängig und stehen miteinander in Korrelation. In der Teamentwicklung, vor allem in internationalen Teams, ist es wichtig diese Korrelationen zu beobachten und wenn notwendig, auch in den formalen Prozessen zu beachten.
Speziell die Unterscheidung zwischen sach- und beziehungsorientierten Kulturen kann hier ein wichtiger Erfolgsfaktor sein. Der, für unseren Kulturraum unnötige, Smalltalk oder die strikte Trennung von Familie und Arbeit kann bei beziehungsorientierten Kulturen zu sehr großen Verunsicherungen führen.
Wie in der Abbildung »Werte und Verhalten« dargestellt, ist die Voraussetzung zur Bildung von Einstellungen die Korrelation zwischen den Werten, der kulturellen Einflüsse des Teammitgliedes und der aktuellen Situation, in der sich Person befindet.
Eine alltägliche Situation kann beispielsweise das Verhalten einer Person in einer Gruppe sein, das sich gegenüber seinem Einzelverhalten unterscheiden kann.

In der Entwicklung von agilen Teams hat diese Erkenntnis zur Folge, dass man beispielsweise nicht den Wert »Fairness« zu erreichen versucht, sondern dass dieser Wert das Verhalten einer Person lenkt, welche dann bestimmte Handlungsweisen in bestimmten Situationen ausführt[22].
[1] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.81.
[2] Dies kann u.a. auch ein der Scrum Master oder Teamberater sein.
[3] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.81.
[4] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.81.
[5] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.82.
[6] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.82.
[7] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.82ff.
[8] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.85.
[9] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.84f.
[10] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.87.
[11] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.87.
[12] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.88.
[13] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.89.
[14] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.90.
[15] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.90.
[16] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.91.
[17] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.91f.
[18] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.93.
[19] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.93f.
[20] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.94.
[21] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.96.
[22] Spieß, Erika, von Rosenstiel, Lutz: Organisationspsychologie, Basiswissen, Konzepte und Anwendungsfelder; 1. Auflage; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH; München; 2010; S.96f.
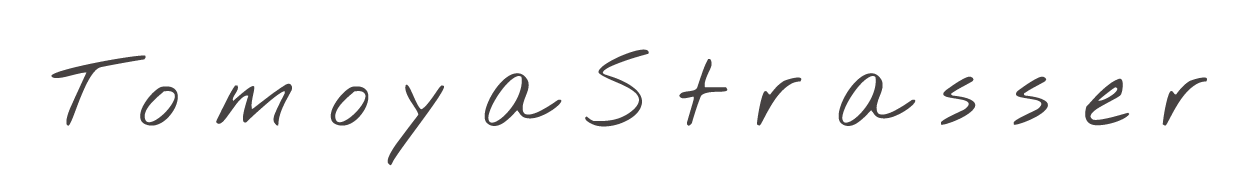
No Comments